
Die Entwicklungshelfer wurden schon vor langer Zeit evakuiert, während die Missionarinnen weiterarbeiten, weil die Menschen sie brauchen. »Wir werden nur mit den von uns Betreuten gemeinsam weggehen«, sagt Schwester Agnieszka Gugała. Die polnische Missionarin arbeitet in Nord-Kivu, wo seit fast drei Jahrzehnten einer der blutigsten Kriege Afrikas tobt.
Schwester Agnieszka ging vor 20 Jahren nach Afrika. Sie erinnert sich, dass sie sich bereits im Gymnasium zur Missionierung berufen fühlte. »Man könnte sagen, dass es die Missionen waren, die mich zur Kongregation der Engelsschwestern geführt haben«, bekennt sie. In den ersten Jahren ihres Ordenslebens arbeitete sie als Katechetin in Schulen und kümmerte sich um Kinder und junge Menschen. Nach ihren ewigen Gelübden erhielt sie die Erlaubnis, nach Afrika zu gehen. Zuerst ging sie nach Ruanda, dann in die Demokratische Republik Kongo. Seit einem Jahrzehnt leitet sie ein Krankenhaus und ein Ernährungszentrum für Kinder in dem Dorf Ntamugenga. Die Missionarin scherzt, sie sei der Mann im Haus: Ihre Aufgaben reichen vom Kauf des Wasserhahns, der Seife und der Medikamente über die Bezahlung des Personals, die Reparatur des Daches und die Suche nach Töpfen und Matratzen für die Flüchtlinge bis hin zu riskanten Fahrten nach Goma, der einzigen Stadt in der Region, wo sie die notwendigen Medikamente, Lebensmittel und Milch für die Kinder, die ihre Mütter verloren haben, besorgt. Während dieser Expeditionen muss sie mehrere Kontrollpunkte passieren, die in der Hand der Rebellen sind. An fast allen muss sie verhandeln, um mit ihrer Hilfsspedition weiterkommen zu können.
Blutige Geschäfte
mit Rohstoffen
Die Einsatzjahre von Schwester Agnieszka in Nord-Kivu sind geprägt von aufeinander folgenden Konflikten, die zwar nachlassen, aber nie enden. »Solange Kinder Zeugen von Verbrechen werden und ihre Ausbildung unterbrechen müssen, wird es in diesem Land keinen Frieden geben«, sagt die Missionarin, der die Zukunft der Jüngsten am Herzen liegt. Die Region wird von über einhundert verschiedenen Gruppen destabilisiert, die versuchen, die Kontrolle über die Kobalt-, Coltan- und Niobvorkommen zu erlangen, die für die Herstellung von Mobiltelefonen benötigt werden. Sie sind wertvoller als Gold und Diamanten, die von den Rebellen ebenfalls geplündert werden. Am meisten leidet die Zivilbevölkerung, die nicht einmal die Krümel von diesen Reichtümern sieht, die ihr Land birgt. Wegen der Gewalt sind die Menschen gezwungen, ihre Häuser und Felder zu verlassen. Im Kongo gibt es mehr als 5,6 Millionen Binnenflüchtlinge.
Die UN-Friedensmission, deren jährlicher Unterhalt das Nationaleinkommen des gesamten Kongo übersteigt, ist nicht in der Lage, die Situation zu ändern.
Die Missionare mischen sich nicht in die Politik ein, sondern versuchen, die gewaltige humanitäre Krise zu bekämpfen, die Nord-Kivu zerstört. »Jeden Tag sterben Menschen an Hunger und an sich verbreitenden Krankheiten. Unsere Anwesenheit macht den Menschen Mut und sorgt für ihre Sicherheit. Sie nennen uns ›unsere Schwestern‹, was bedeutet, dass wir ihnen sehr nahe sind«, so Schwester Agnieszka.
Trotz ihrer zerbrechlich wirkenden Gestalt ist sie unter Kriegsbedingungen ein Bezugspunkt für Tausende von Menschen in Not. Dabei wird sie tapfer von zwei Mitschwes-tern aus Ruanda und dem Kongo unterstützt. »Wir sind nur dank der Vorsehung Gottes am Leben geblieben, die Bomben fielen um unser Kloster herum. Ein paar Meter weiter und wir wären gestorben. Sie brachten uns die Verwundeten, die Wände waren rot vor Blut«, erzählte sie von einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Region.
»Weitere Flüchtlinge kamen in der Mission an, und das von den Schwestern geleitete Krankenhaus platzte aus allen Nähten, als es 5.000 Patienten, darunter viele Verwundete, aufnehmen musste. Derzeit hat sich die Front von der Mission entfernt, aber die Situation ist immer noch sehr turbulent.«
Das Kloster
als Zufluchtsort
Die Missionarinnen sind eine Anlaufstelle vor allem für Frauen mit Kindern, die bei den ersten Anzeichen von Gefahr Zuflucht in ihrem Kloster suchen. Wenn es ruhiger wird, besorgt Schwester Agnieszka Hilfsgüter und versucht, so viel Hilfe wie möglich aus dem Ausland zu bekommen. Diese Weitsicht hat schon oft Leben gerettet. »Unter normalen Umständen grenzt es schon an ein Wunder, medizinische Hilfe zu bekommen, aber wenn sich die Situation verschlimmert, wird es unmöglich«, sagt die Missionarin. Die Engelsschwestern betreiben eine Essensausgabe, die trotz des Konflikts ununterbrochen in Betrieb ist. »Fast die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren in dieser Region leidet an chronischer Unterernährung. Tuberkulose und Malaria stellen nach wie vor eine große Herausforderung dar. Malaria fordert hier immer noch die meisten Todesopfer«, berichtet Schwester Agnieszka.
Auf die Frage nach den Träumen der Missionarinnen antwortet sie, wie viele Bewohner der Region: »Dauerhafter Frieden. Dieses Land ist fruchtbar und die Menschen könnten hier in Sicherheit und Würde leben«, sagt die Missionarin. Doch als ob das bisher erlittene Unglück noch nicht genug wäre, beginnen Dschihadisten, die mit dem so genannten Islamischen Staat in Verbindung stehen und aus dem benachbarten Uganda stammen, in der Region aufzutauchen. Es häufen sich Berichte über Massaker an wehrlosen Menschen und die Vergewaltigung von Frauen und Kindern.
Die Missionarin erinnert uns an die Aufforderung von Papst Franziskus, die gierigen Finger von Afrika zu lassen. Sie betont, dass der Besuch des Papstes im Kongo eine Gelegenheit war, Licht in diesen vergessenen Winkel der Welt zu bringen und die dringend benötigte humanitäre Hilfe dorthin zu leiten. Gemeinsam mit anderen Engelsschwestern bittet sie um Gebet, damit sie über die Kraft und Gesundheit verfügen mögen, die nötig sind, um ihre Mission fortzusetzen.
#sistersproject
Von Beata Zajaczkowska, Vatikan













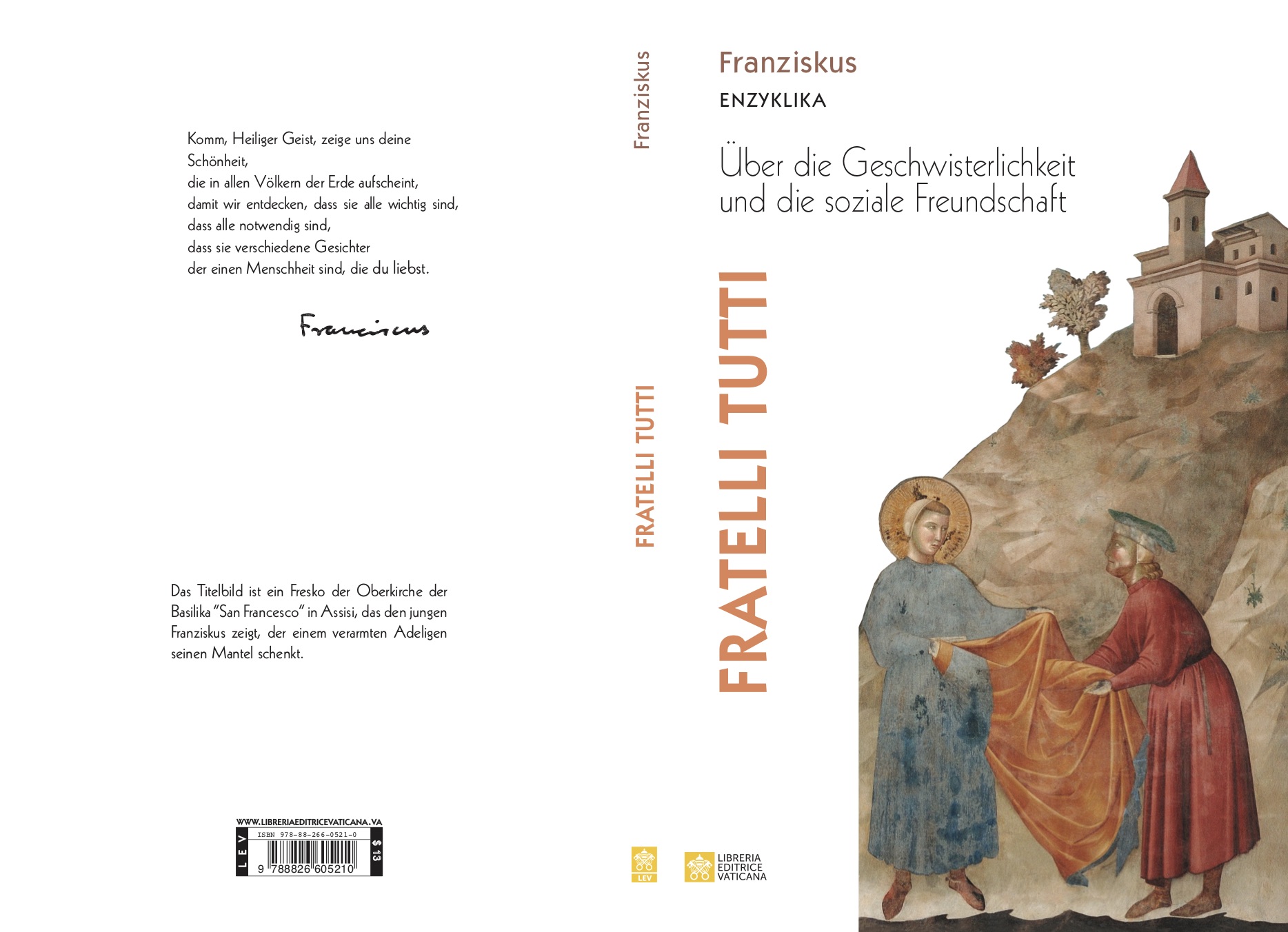 Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti
